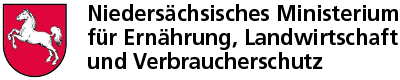Essen und Trinken bei Hitze

Bild: ©beast01/Bigstock.com
Der Klimawandel macht sich längst bemerkbar und Hitzeperioden nehmen zu. Viele Einrichtungen der Gemeinschaftsgastronomie bzw. -verpflegung stellt das vor große Herausforderungen. Welche Speisen und Getränke sind bei Hitze angesagt? Wie kann eine ausreichende Versorgung in Kitas, Schulen, Betrieben, Kliniken, Einrichtungen für Senior*innen und bei „Essen auf Rädern“ gewährleistet werden? Hier finden Sie Tipps für „heiße Zeiten“.
Hitze belastet den menschlichen Organismus. Bei hohen Temperaturen sind wir nicht so leistungsfähig wie gewohnt, schlafen schlechter und schalten gerne einen Gang zurück. Das ist auch gut so, denn bei Hitze sollte man körperliche Anstrengung reduzieren, den Aufenthalt im Schatten bzw. in Räumen mit moderaten Temperaturen suchen und luftige, temperaturausgleichende Kleidung tragen. Das ist jedoch für viele Menschen nicht möglich, da sie schützende Berufskleidung benötigen und/oder im Freien arbeiten müssen (z. B. Baustellenarbeiter*innen) oder Räume nicht ausreichend gekühlt werden können (z. B. in Fahrzeugen, Schulen, Heimen, Krankenhäusern, Unterkünften für Geflüchtete).
Untersuchungen zeigen, dass die Bandbreite der Maßnahmen zur Hitzeadaptation (z. B. Arme kühlen, mehr trinken, sich in kühlen Räumen aufhalten) insbesondere von älteren Menschen nicht voll ausgeschöpft wird (White-Newsome et al. 2011). Außerdem hängt hitzeangepasstes Verhalten offenbar von Einkommen, Bildungsstand, sozialen Kontakten und dem Gesundheitszustand ab (Kemen et al. 2021, van Loenhout und Guha-Sapir 2016).
Kinder und ältere Menschen schwitzen weniger
Eine einfache Definition von „Hitzestress“ ist nicht möglich, da viele Faktoren beteiligt sind, wie Lufttemperatur, Sonneneinstrahlung, Luftfeuchtigkeit, Wind, Bekleidung, körperliche Aktivität und Gewöhnung (Akklimatisierung) (McCubbin et al. 2020).
Um die Körperkerntemperatur konstant zu halten, wird der Blutfluss zur Haut verstärkt, damit überschüssige Wärme besser über die Haut abtransportiert wird (Kenny und Jay 2013). In geringerem Maße geht Wärme direkt über die Haut verloren (Konvektion), der weitaus größere Teil wird als Schweiß „abgedampft“ (Evaporation). Dabei entsteht Verdunstungskälte mit einem kühlenden Effekt auf der Haut. Dafür muss das Herz jedoch stärker pumpen und benötigt entsprechend mehr Sauerstoff (Cramer et al. 2022). Da (aktive) ältere Menschen weniger Schweiß absondern können als jüngere Menschen (Nose et al. 2018), verlieren sie zwar weniger Flüssigkeit, sind gleichzeitig aber vulnerabler für Wärmebelastung und die Gefahr eines Hitzschlags. Dazu kommt, dass das Durstgefühl im Alter nachlässt, auch nach vorübergehendem Flüssigkeitsmangel (Begg 2017).
Senior*innen empfinden trotz erhöhter Osmolalität des Speichels weniger Mundtrockenheit (Xerostomie) als jüngere Menschen (Mentes et al. 2019). Säuglinge und Kinder schwitzen ebenfalls weniger; ihr Organismus ist noch nicht fähig, sich an Klimaextreme anzupassen (Elmadfa und Leitzmann 2019). Weitere besonders vulnerable Personengruppen für einen hitzebedingten Flüssigkeitsmangel sind Obdachlose, Patient*innen in Kliniken (v. a. mit Herz-, Nieren- und Lungenerkrankungen oder postoperativ) und an Demenz erkrankte Personen (Ebi et al. 2021, Zanobetti et al. 2013).
In einer großen Kohortenstudie waren Dehydrierungszustände bei 51- bis 70-Jährigen mit einer erhöhten Prävalenz für Adipositas, hohem Taillenumfang, Insulinresistenz, Typ-2-Diabetes, niedrigem LDL-Cholesterol, metabolischem Syndrom und Hypertonie assoziiert (Stookey et al. 2020). Ein erhöhtes Sterberisiko durch Dehydrierung haben immobile Personen (bettlägerig, hilfsbedürftig und/oder unfähig, allein das Haus zu verlassen) und Menschen mit fehlenden Sozialkontakten; Patient*innen mit Herz-Kreislauf- oder psychiatrischen Erkrankungen sind ebenfalls stark gefährdet (Bouchama et al. 2007).
Medikamente, die dem Körper Flüssigkeit entziehen oder die Temperaturregulation stören (z. B. Entwässerungsmittel, Antihypertensiva, Schlafmittel), können das Dehydrierungsrisiko verschärfen (Westaway et al. 2015). Da in vielen Privatwohnungen „die Hitze steht“, sollten Pflegedienste und pflegende Angehörige älterer Menschen besonders aufmerksam sein. Auch viele Senior*innen in Einrichtungen passen ihre Trinkgewohnheiten in warmen Räumen nicht entsprechend an (Williams et al 2019).
Mangel an Flüssigkeit, an Elektrolyten oder beides?
Hitzestress kann sich durch Muskelkrämpfe, starkes Schwitzen, Angstgefühle, Fatigue und Verwirrtheit äußern (White-Newsome et al. 2011). Im Magen-Darm-Trakt finden bei hoher körperlicher Anstregung unter Hitze (vorübergehende) Veränderungen statt (verminderte Durchblutung des Gastrointestinaltrakts und verminderte Funktionskapazität durch Sympathikusaktivierung), die zu Schädigungen der Darmmukosa und -permeabilität sowie verhinderter Absorption von Nährstofffen führen können (McCubbin et al. 2020). Für Erwerbstätige mit arbeitsbedingtem Hitzestress zeigte eine systematische Untersuchung, dass 15 % eine Nierenerkrankung oder akute Nierenstörung entwickelten (Flouris 2018).
Durch das Schwitzen geht viel Flüssigkeit verloren und es kann zu Dehydrierungszuständen (Dehydratation) kommen, die bei Verlusten von mehr als 8 % des Gesamtkörperwassers oft tödlich enden (Grandjean et al. 2003). Leichte Flüssigkeitsdefizite vermindern Thermoregulation, körperliche Leistungsfähigkeit und Appetit. Stärkere Defizite führen zu Kopfschmerzen, erhöhter Körpertemperatur und Atemfrequenz, verlängerter Reaktionszeit, Konzentrations- Aufmerksamkeitsverlust, nachlassender Körperkraft/-ausdauer, Schwäche bis zum Delirium, Schädigung der Nieren bzw. Nierenversagen, Reizbarkeit und Ungeduld; aber auch Apathie, Verwirrtheit oder Schläfrigkeit sind möglich (Benton et al. 2016, Johnson et al. 2022, Watso und Farquhar 2019).
Bei noch stärkeren Verlusten treten häufig kardiovaskuläre Störungen auf – mit gesteigerter Herzfrequenz und Beeinträchtigungen der Blutdruckregulation (Charkoudian 2003). Da einer der wesentlichen diagnostischen Parameter für eine Dehydrierung, die Serumosmolalität, im Alltag oft unbekannt ist, kann die Anzahl der Toilettengänge (bzw. der Füllzustand von Hygienevorlagen) in Kombination mit der Urinfarbe zur Beurteilung dienen.
Dehydrierungszustände können hypertonisch, isotonisch oder hypotonisch sein (Benton 2011). Bei Hitze bedarf die hypotonische Form besonderer Aufmerksamkeit, denn dabei kommt es osmotisch bedingt zu einer intrazellulären Dehydrierung, z. B. durch starkes Schwitzen, gastroenterale Flüssigkeitsverluste oder wenn versucht wird, Flüssigkeits- und Elektrolytverluste nur durch elektrolytarmes Wasser auszugleichen (Grandjean 2003). Wichtig ist ein regelmäßiger Ausgleich der über das Schwitzen, den Urin sowie unsichtbare Verluste (Atmung, Verdauungstrakt) ausgeschiedenen Wasser- und Elektrolytmengen.
Wie viel Wasser braucht der Mensch?
Hitzebedingte Dehydrierungszustände lassen sich u. a. durch eine adäquate Trinkmenge, regelmäßige (kleine) Mahlzeiten und den Verzicht auf Alkohol verhindern (WHO 2018). Den Flüssigkeitsbedarf pauschal zu bestimmen, ist nicht möglich (Wirth 2022). Er hängt von diversen individuellen Faktoren ab (z. B. körperliche Aktivität, Alter, Erkrankungen) und muss bei extremen Bedingungen angepasst werden. Die Zufuhrempfehlungen der DGE für Wasser werden derzeit aktualisiert.
Bei Hitze sollte man (tagsüber) alle 1 bis 2 Stunden ein Glas Wasser (0,2 Liter) trinken, auch wenn man noch nicht durstig ist.Internationale Fachgesellschaften haben teils sehr unterschiedliche Empfehlungen veröffentlicht. Da das Durstgefühl meist erst einsetzt, wenn bereits viel Flüssigkeit verloren wurde, ist eine einfache Faustregel sinnvoll: Bei Hitze sollte man (tagsüber) alle 1 bis 2 Stunden ein Glas Wasser (0,2 Liter) trinken, auch wenn man noch nicht durstig ist. Bei einem hohen Wasserbedarf können wasserreiche Speisen (Suppen, Salate, Obst, Joghurt usw.) zusätzlich sehr gut zu einer bedarfsdeckenden Versorgung mit Flüssigkeit beitragen.
Im Alltag ist eine exakte(re) Angabe einer bestimmten Tagestrinkmenge wenig zielführend, außer in der klinischen Ernährung oder bei Patient*innen, die eine Flüssigkeitsrestriktion benötigen – hier gelten die entsprechenden Leitlinien der einzelnen medizinischen Fachgesellschaften (u. a. Volkert et al. 2022). Da insbesondere ältere Menschen für Hitzestress sehr vulnerabel sind, ist für sie eine rasche Kompensation von Wasserverlusten essenziell (Brennan et al. 2019).
Abwechslung, Geschmacksvielfalt – und Leitungswasser!
Leitungswasser ist in Deutschland überall verfügbar, wird streng kontrolliert, hat eine gute Qualität und liefert im Gegensatz zu vielen anderen Getränken (Softgetränke, Energydrinks, Biermixgetränke) keine zusätzliche Kalorien. Aber nicht jede*r mag (pures) Leitungswasser. Zahlreiche Varianten bieten mehr Geschmack: verdünnen mit Gemüse- oder Obstsäften (1 Teil Saft, 3 Teile Wasser), ein Spritzer Zitrone, Limone oder Orange oder ein Zweig frische Minze.
Wer Mineralwasser bevorzugt, kann bei Hitze zu stärker natriumchloridhaltigen Sorten greifen oder eine Prise Salz zugeben, um Salzverluste durch das Schwitzen auszugleichen. Die pauschalisierte Empfehlung zu salzarmer Ernährung gilt bei Hitze nur eingeschränkt. Als Kräuter- oder Früchtetee oder Mixgetränk mit einem kleinen Anteil Saft bietet Leitungswasser ebenfalls viele Optionen.
Auch auf Kaffee, eines der beliebtesten Getränke in Deutschland, muss bei Hitze nicht komplett verzichtet werden. Die Legende, dass Kaffee dem Körper Flüssigkeit entzieht, ist längst widerlegt (Killer et al. 2014). Eine bis vier Tassen Kaffee pro Tag gelten als unbedenklich (Barrea et al. 2023). Allerdings führt die diuretische Wirkung zu häufigerer Miktion, und die ausgeschiedene Flüssigkeit muss wieder ersetzt werden. Der südliche Brauch, zu jeder Tasse Kaffee ein Glas Wasser zu reichen, ist daher stimmig. Bei Hitze ist Kaffee dennoch nicht uneingeschränkt empfehlenswert, da die kreislaufanregende Wirkung des Koffeins das Hitzegefühl verstärkt. Wen Kaffee (oder Grün-/Schwarztee) um den Nachtschlaf bringt, der*die sollte den Konsum deutlich reduzieren bzw. ab dem Nachmittag darauf verzichten. Eine Alternative bieten Getreide- und entkoffeinierter Kaffee. Kaffee ist für Kinder nicht geeignet; koffeinhaltige Energydrinks sind für niemanden empfehlenswert (DGE 2021).
In vielen industriell hergestellten Softdrinks ist der Gehalt an Zucker bzw. Süßungsmitteln, künstlichen Aromen und anderen Zusatzstoffen sehr hoch. Sehr zuckerreiche Getränke wie Softdrinks, unverdünnte Fruchtsäfte, Fruchtsaftgetränke oder -nektare wirken sich zudem ungünstig auf die Insulinkonzentration im Blut aus. Zwischen den Mahlzeiten konsumiert können sie zu starken Schwankungen der Insulinausschüttung führen – für vulnerable Personen eine weitere Belastung des Organismus.
Gesüßte Getränke sollten Ausnahmen bleiben (z. B. bei besonderen Anlässen). Sie können zur Deckung der Flüssigkeitszufuhr als eine genussvolle Alternative genutzt werden, falls vulnerable Personen nur durch ein sehr abwechslungsreiches Angebot genug trinken. Für hochbetagte Menschen, die andere Getränke ablehnen, ist es besser, auf gesüßte Getränke zurückzugreifen als einen Dehydrierungszustand zu riskieren.
Die Art der Getränke ist auch eine Kostenfrage: Leitungswasser mit einem Spritzer Saft ist in der Regel günstiger als ein industriell hergestelltes Mixgetränk und spart viel Verpackungsmüll.
Milch/Joghurt- oder Milchmixgetränke zählen aufgrund ihres Nährstoffgehalts zu den Lebensmitteln. Sie können bei Hitze auch mal eine Mahlzeit ersetzen – am besten selbst hergestellt, da die meisten industriellen Angebote zu viel Zucker enthalten. Angereichert mit frischem, saisonalem Obst bieten sie eine gute Ergänzung zur Wasserzufuhr, die ganz nebenbei viele Mineralstoffe und Vitamine liefert.Menschen aus südlichen Ländern bevorzugen häufig die gesalzene Variante des Joghurtdrinks: 1 Teil Joghurt, 1 Teil Wasser, etwas Salz (und Minze) – fertig ist Ayran, ein ideales Hitze-Getränk, das den Salzverlust durch das verstärkte Schwitzen ausgleicht.
Arbeiter*innen auf Baustellen und auf anderen hitzebelasteten Arbeitsplätzen sollten dafür sensibilisiert werden, ihre Flüssigkeitsverluste nicht durch allzu schnelles Trinken hypoosmolarer Flüssigkeiten (wie Leitungswasser ohne Salzzusatz) zu kompensieren (s. o.). Gerade für sie gilt es, Salzverluste auszugleichen. Als eine weitere Alternative bietet sich dabei gelegentlich auch mal ein alkoholfreies Bier an.
Je weniger ein Mensch isst, desto mehr sollte er trinken, da bei geringer Nahrungszufuhr weniger in der Nahrung enthaltenes Wasser zugeführt wird und weniger Oxidationswasser entsteht, jedoch weiterhin harnstoffpflichtige Substanzen anfallen. Außerdem sollte dann über Getränke (s. o.) dafür gesorgt werden, dass die (Mikro-)Nährstoffzufuhr stimmt. Alkoholkonsum wirkt diuretisch und stört den Ausgleich eines vorherigen Flüssigkeitsmangels (Shirreffs und Maughan 1985).
Farbe auf den Tisch: leichte Speisen, kleine Mahlzeiten
An heißen Tagen sind überwiegend pflanzenbasierte Mahlzeiten anstelle von „gehaltvollen“ fleischlastigen Speisen sinnvoll. Ein Grund dafür liegt im „thermischen Effekt“ der Nahrung (TEF). Für die Verdauungsprozesse wird Energie benötigt und dabei Wärme freigesetzt. Der TEF hat einen Anteil von ca. 10 % am Gesamtenergieverbrauch; bei größeren Mahlzeiten steigt der TEF ebenso wie bei proteinreichen Speisen an (Calcagno 2019). Schon allein deshalb sind bei Hitze kleinere, weniger fleischlastige Mahlzeiten empfehlenswert.
In der traditionellen chinesischen Medizin (TCM) und im Ayurveda wird die thermische Wirkung von Lebensmitteln bzw. deren kühlende/wärmende Effekte seit Jahrhunderten genutzt. Scharfe Gewürze wie Ingwer, Chili, Senfpulver, Wasabi und Meerrettich gelten als „Heißmacher“. Für das Capsaicin in Chilischoten wurde dieser Effekt nachgewiesen (Lee et al 2000); ansonsten sind die östlichen Anwendungslehren kaum wissenschaftlich belegt. Gleichwohl stimmen viele Empfehlungen für heiße Tage, z. B. Kräutertees, Buttermilch, Obst, Salat und Verzicht auf Fleischprodukte mit wissenschaftlich basierten, westlichen Empfehlungen überein.
Ganz ohne scharfe Gewürze können in der Gemeinschaftsgastronomie bzw. -verpflegung pflanzenbasierte Gerichte zubereitet werden, die geschmacklich von Natur aus überzeugen. Maßvolles Nachsalzen ist bei Hitze sogar erwünscht, z. B. um eine leckere, kalte Gazpacho zu würzen.
Motivierend für Jung und Alt kann die Bereitstellung von Gemüse und Obst in Form von Fingerfood sein: Möhren- oder Kohlrabisticks oder Apfelschnitze – so kommt viel Flüssigkeit mit einem Plus an sekundären Pflanzenstoffen, Vitaminen und Mineralstoffen in den Magen. Gemeinsames Zubereiten und appetitliches Anrichten kann ggf. die Lust auf solche Mahlzeiten steigern.
Für Personen mit Kaubeschwerden eignen sich fein geriebene, saftige Rohkostsalate oder Gemüse und Obst als Smoothies. Dabei sollten vorzugsweise regional angebaute Lebensmittel zum Einsatz kommen, z. B. heimische Beerenfrüchte statt Melonen aus Spanien.
Zahlreiche wasserreiche Gemüsesarten sind einheimische Saisonware, wie Rettich, Radieschen, Fenchel, Salatgurken oder Tomaten. Leichte Kartoffel- oder Nudelgerichte mit Gemüsesoßen, kühle Gemüsesalate, knackige Rohkost (oder bei Kauproblemen weiche, gedämpfte Gemüsesarten) mit Dips – die Vielfalt an wasserreichen, leckeren Sommermahlzeiten ist schier unendlich.
Unterstützung in vielfacher Form: Apps, Medien oder Trinkpläne
Derzeit hängt die Sicherstellung einer angemessenen Flüssigkeitszufuhr v. a. von individuellen, sozialen, psychologischen, betriebswirtschaftlichen und/oder arbeitstechnischen Faktoren ab. Entscheidend sind u. a. die Verfügbarkeit (z. B. Haushaltsbudget, sorgfältige Einkaufsplanung, Lieferdienste, Außer- Haus-Versorgung), das Trinkverhalten sowie Hilfestellung für Personen, die nicht in der Lage sind, selbstständig zu trinken.
Für ältere Menschen mit vermindertem Durstgefühl, aber auch für Kinder sind die Motivierung zum Trinken und die Bereitstellung adäquater Getränke sehr wichtig (Volkert et al. 2022). Ein einfacher Zugang zu Getränken kann in Kitas, Schulen und Betrieben, sowie in Kliniken und Senior*inneneinrichtungen durch Trinkwasserspender an oft frequentierten Stellen bestehen. In Privathaushalten lebende Personen sollten täglich das Radio oder andere Medien nutzen, damit Hitzewarnungen Gehör finden (Kemen et al. 2021). Bei älteren Menschen können auch prominent platzierte Tagestrinkpläne helfen. Dasselbe gilt für im Home-Office tätige Personen.
Bei Schulkindern zeigen Kohortenstudien hohe Anteile von Dehydrierungszuständen (Kenney et al. 2015). Daher sollten Erziehungsberechtigte bzw. das Personal in Heimen, Kitas und/oder Schulen entsprechende Angebote bereitstellen bzw. ausreichend Getränke für die Schule mitgeben und immer wieder ans Trinken erinnern. Zudem muss genügend Zeit für Trinkpausen vorhanden sein. Kleinere Kinder können sich noch nicht selbst versorgen, sind häufig zu sehr ins Spielen vertieft und schätzen – ebenso wie viele ältere Kinder – ihren Flüssigkeitsbedarf nicht richtig ein (Coppinger und Howells 2019). Außerdem ist eine adäquate Ausstattung mit Sanitäranlagen essenziell, da viele Schüler*innen eher auf das Trinken verzichten als Schultoiletten aufzusuchen (Michels et al. 2019). Vor dem Sport sollte der Körper ausreichend mit Flüssigkei versorgt sein (Lee 2022).
An Eiswürfeln scheiden sich die Geister
Viele Menschen empfinden eishaltige bzw. eiskalte Speisen und Getränke bei Hitze als sehr angenehm und kühlend im Mund. Das trifft übrigens auch auf Mentholbonbons oder -lösungen zu (McCubbin et al. 2020). Experimentell löschten kalte Getränke das Durstgefühl durch orale Kühlungseffekte tatsächlich eher als wärmere Getränke (Eccles et al. 2013).
Als noch stärkere Durstlöscher gelten feste, kalte, aromatisierte Produkte wie Speiseeis (van Belzen 2017). Für die Geschwindigkeit, mit der Flüssigkeitsverluste ausgeglichen werden, sind neben der absoluten Zufuhrmenge die Dauer der Magenentleerung und der intestinalen Absorption entscheidend (Leiper 2015); körperliche Aktivität und Hitze verlangsamen die Magenentleerung (Neufer et al. 1989).
Die Getränketemperatur hat durch rasche Temperaturangleichung im Magen wenig Einfluss auf die Geschwindigkeit der Magenpassage auch der Getränke-pH-Wert wirkt sich nur gering aus (Leiper 2015). Kleine Studien mit hitzebelasteten Arbeiter*innen zeigen, dass es keinen Unterschied im Hinblick auf die Trinkmenge macht, ob Getränke gekühlt sind oder Umgebungstemperatur haben (Jung et al. 2007). Nach heutigem Wissensstand ist es eher eine Frage der Vorlieben und der individuellen Verträglichkeit, ob eisgekühlte, zimmerwarme oder heiße Getränke konsumiert werden sollten. Bei eisgekühlten Getränken ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass mehr getrunken wird (Brearley 2017).
Der Beitrag stammt von Dr. Karin Kreuel und wurde zuerst im Wissenschaftsmagazin DGEwissen in der Juli -Ausgabe 2023 veröffentlicht.
Quelle, weitere Tipps und Literatur: Deutsche Gesellschaft für Ernährung e. V., Blog