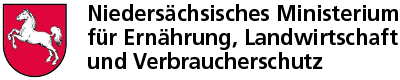Wie nachhaltig sind Speisenproduktionssysteme in der Gemeinschaftsverpflegung?

Bild: ©beast01/Bigstock.com
In Einrichtungen der Gemeinschaftsverpflegung essen deutschlandweit täglich etwa 16 Millionen Menschen. Umso wichtiger ist es daher, die Art und Menge eingesetzter Ressourcen für eine ausgewogene und nachhaltigere Ernährung zu analysieren. Denn sie unterscheiden sich je nachdem, welches Speisenproduktionssystem verwendet wird.
Im Interview sprechen die Autorinnen Silke Thiele, Mareike Täger und Linda Chalupová über die Herausforderungen der im 15. DGE-Ernährungsbericht veröffentlichen Studie: „Analyse und Bewertung gängiger Speisenproduktionssysteme in der Gemeinschaftsverpflegung hinsichtlich einer nachhaltigen Produktionsweise“.
Silke Thiele:
Positiv aufgefallen ist uns während der Bearbeitung vor allem das große Interesse aus der Praxis. Viele Verantwortliche möchten wissen, welches Speisenproduktionssystem sich in ihrem Betrieb für eine nachhaltige Produktionsweise eignet und wie sie ihre Betriebe durch die passende Wahl weiterentwickeln können. Als Herausforderungen haben sich hingegen die große Heterogenität der Betriebe in der Gemeinschaftsverpflegung sowie die bestehenden Datenlücken in diesem Bereich erwiesen. Beides erschwert es, allgemeingültige Aussagen abzuleiten und zeigt den Bedarf an weiterer Forschung.
Dr. Täger, welche zentralen Erkenntnisse konnten Sie gewinnen und welche Erkenntnisse oder Studienergebnisse haben Sie überrascht?
Mareike Täger:
Das zentrale Ergebnis unserer Studie ist eine Bewertungsübersicht, die verschiedene Faktoren in den Dimensionen Umwelt, Gesundheit und Soziales zwischen den Speisenproduktionssystemen vergleicht. Dabei zeigte sich, dass es kein einheitlich „bestes“ System gibt – je nach Dimension und Indikator können unterschiedliche Systeme Vorteile haben. Überraschend war dabei für uns, dass das Verfahren Cook & Hold beim Energieverbrauch so gut abgeschnitten hat. Das Warmhalten erwies sich als weniger energieintensiv, als wir zunächst angenommen hatten. Auch, dass Cook & Hold in Bezug auf die Nährstoffverluste am zweitbesten abschnitt, hat uns erstaunt. Gerade bei kurzen Warmhaltezeiten fallen die Verluste vergleichsweise gering aus. Allerdings beruhen die Studien hierzu überwiegend auf älteren Daten, und es gibt in diesem Bereich bislang nur wenig aktuelle Forschung.
Frau Prof. Dr. Chalupová, was können unter anderem Praktiker*innen und Anbietende, wie beispielsweise Caterer, aus den Studienergebnissen schließen und was nicht?
Linda Chalupová:
Die Ergebnisse bieten eine strukturierte Orientierung, um systembedingte Unterschiede sichtbar zu machen. Hieraus können Checklisten und Entscheidungshilfen abgeleitet werden. Nicht ableitbar sind pauschale Empfehlungen, ein endgültiges Ranking oder standortspezifische Effekte ohne Feldtest.
Frau Prof. Dr. Chalupová, welche nächsten Schritte ergeben sich für die Indikatoren und Bewertungsmatrix und was wünschen Sie sich für Ihre Pilotstudie?
Linda Chalupová:
Für Indikatoren und Bewertungsmatrix sehe ich drei Schritte:
- Übertragung auf weitere Versorgungsbereiche und Ergänzung um setting-spezifische Kriterien
- Operationalisierung in praxistaugliche Checklisten/Entscheidungsbäume,
- methodische Schärfung durch standardisierte Mindestdatensätze und, wo möglich, Sensitivitätsanalysen zur Abfederung von Datenlücken.
Für die Pilotstudie wünsche ich mir Erprobung unter Realbedingungen in ausreichend diversen Einrichtungen, die Personalknappheit, Budgetrestriktionen sowie technische/räumliche Limits explizit mitmessen.
Ziel ist keine One-size-fits-all-Empfehlung, sondern belastbare, kontextbezogene Orientierung für die Auswahl und Weiterentwicklung nachhaltiger SPS.
Vielen Dank für das Gespräch.
Quelle, weitere Informationen und mehr zu den Interviewpartnerinnen: Deutsche Gesellschaft für Ernährung e. V., Blog